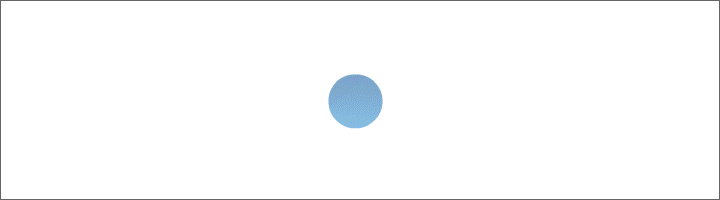Wer mit viel Mühe viele Bücher durchblättert hat,
verachtet das leichte, einfältige Buch der Natur.
Und ist doch nichts wahr,
als was einfältig ist.
Goethe.
Zum zweitenmal rief mich der lenzliche Wald. Beim erstenmal war der Frühling noch herb, obgleich die Stare schon seit Wochen vom kahlen Buchenwipfel herab den Kehraus für den Winter pfiffen, die Kohlmeise selig ihr Glöckchen schwang und vor mir dieselbe Heimaterde, die gestern noch die alte hieß, den feinen, wundersamen Duft zurückgewonnener Jugendfrische der Ackerkrume entströmen ließ. Jetzt war dem bebenden Erwarten endlich Erfüllung zuteil geworden. Um das in sattes Braun getauchte Gezweige der Birken am Waldessaum hob ein geschäftiges Weben an, und über die Wipfel der grauen Buchen breitete sich ein purpurner Schimmer. Aus allen Zweigenden der Gebüsche lugten frischgrüne Spitzen hervor, und aus der Waldtiefe wehte ein Lüftchen würzigen Mandelgeruch heran: der Seidelbast glühte im Schmuck seiner Blüten und warb um den Anflug von Bienengästen, bevor der sich steigernde Laubausbruch der Sonne den Durchblick verweigerte.
Auch sonst war der Wald schon mit Anmut geschmückt. All die vertrauten Frühlingskinder in weißen und purpurnen Gewändern, in Gold, Violett und Blau gekleidet, Anemonen, Lerchensporn, Lungenkraut, Feigwurz, Leberblümchen, Veilchen und was sie sonst für Namen trugen, streckten ihre Blütenköpfchen lebensfroh aus dem gelbbraunen Fallaub. Das Meisenvolk war nicht mehr tonangebend, so lebhaft es auch am Waldesrand seine Gegenwart zu erkennen gab. Die Amsel, der Sänger im schwarzen Frack, auf dem höchsten Buchenzweige thronend, hatte die Kehle bereits gestimmt, Finken schmetterten ihre Strophe »ziziziziziwitjiu«, Goldammer leierte ihren Vers, der trotz seiner kunstlosen Einfachheit so gut in die Frühlingsstimmung paßte, und über den Feldern und trockenen Wiesen, auch sie schon mit bunten Blumen bestickt, kletterten jubelnde Lerchen ins Blau. Mit hundert Tönen, Farben und Rüchen lockte der sich verjüngende Wald, derweil ich, am silbernen Birkenstamm lehnend, die Blicke ins Weite wandern ließ. Hoch über all diesem Hoffnungsglück, über allem Drängen und Knospensprengen, Blühen, Duften und Jubilieren zogen am lichten Himmelsgewölbe zierliche weiße Wölkchen dahin, und als in die jauchzende Feiertagsstunde dann noch ein helles Sonntagsläuten vom Kirchturm des nahen Dorfes hereinklang, da war mir, als müsse ich die Arme vor Seligkeit auseinanderbreiten, um auszudrücken, was ich empfand.
Ob wohl in andern der Ruf des Waldes die gleichen Empfindungen wach werden läßt? Es muß wohl so sein, denn seit Menschengedenken geht ein geheimnisvoller Zauber vom Wirken und Weben des Waldes aus, gleichviel ob seine Wipfel rauschen wie fernher tönender Orgelklang oder ihn tiefernstes Schweigen erfüllt, gleichviel ob er im Lenzgrün prangt oder herbstliche Stürme mit welken Blättern ein tolles Wirbelspiel in ihm treiben, die Glut des Mittsommers über ihm flimmert oder der Winter die kahlen Äste in Schnee oder glitzernden Rauhreif hüllt. Es geht eine magische Kraft aus vom Walde, ein unbestimmbares Weißnichtwas, das sänftigend auf Gemüt und Seele und anregend auf die Sinne wirkt. Zu allen, die zu ihm kommen, spricht er, immer auf eine besondere Art. Den von inneren Bedrängnissen Erfüllten spendet er Trost in die kranke Seele. Den Fröhlichen öffnet er Herz und Mund, daß ihnen im Anblick der Schönheit ringsum von selbst ein Lied von den Lippen quillt. In Kinderherzen läßt er die Helden des Märchenbuches lebendig werden, von denen in traulichen Dämmerstunden die Mutter so viel zu erzählen wußte: Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, und horchenden, sehenden Wanderern erzählt er tausendundeine Geschichten von Pflanzenwundern und Wundertieren, die oft viel märchenhafter sind als die Geschichten der Brüder Grimm. Vollinhaltlich gilt das indessen nur für den deutschen Menschen im deutschen Wald. Ihm ist als Erbteil aus Vorvätertagen, da Deutschlands Boden zu etwa zwei Dritteln im dichten grünen Urpelz steckte, der Zug zur Natur fest eingefleischt, und die Natur verkörpert sich ihm noch immer am reinsten in seinem Wald, wo sie zugleich am ursprünglichsten ist.
Freilich, der Urpelz, der echte Naturwald, ist seit Jahrhunderten schon dahin. Bloß spärliche Reste sind übriggeblieben, in Süddeutschland, in den deutschen Alpen und hier und da noch anderswo. Was wir für gewöhnlich als Wald bezeichnen, ist nur ein ärmlicher Ersatz für die gemordete Vollnatur in Urwüchsigkeit und Ursprünglichkeit, ist »Forst«, unter Zwangszucht geratener Wald.
Dennoch: es leben in diesen Forsten die altehrwürdigen Bäume von einst. Es lebt die gewaltige, knorrige Eiche unverändert in Art und Gestalt, Symbol deutscher Kraft und Zähigkeit. Noch gibt es vereinzelte trotzige Recken, ehemals Glieder im Waldverband, die fünfhundert, achthundert, tausend Jahre siegreich dem Zeitensturm widerstanden, wenn auch schwer mitgenommen vom Kampf. Es stehen Buchen, Linden, Ulmen, Birken und Eschen im heutigen Forst, und wenn er auf Nadelhölzer beschränkt ist, beherbergt er neben Fichten und Kiefern, Lärchen und Tannen wohl auch noch Eiben, aus deren Holz die alten Germanen sich ihre Waffe, den Bogen, schufen. Dieselben Sträucher, dieselben Kräuter, dieselben Blumen wie Anno einst. Erloschen ist glücklicherweise keines von den Gewächsen der Urväterzeit. So haben wir uns damit abgefunden, daß Deutschland bis auf wenige Schlupfwinkel keinen echten Naturwald mehr hat, und Forste für Wälder zu nehmen gelernt. Wir brauchen etwas für Geist und Gemüt, das gleichzeitig Sinnbild für Deutsch und Heimat und Ausdruck für Unvergängliches ist. Etwas, das im ewigen Gleichklang, unabhängig vom Wandel der Zeiten, durch die Flucht der Jahrhunderte geht und damit Natursinn und Heimatgefühl in uns und den Nachkommen
wach erhält. Das deutsche Volk ist von Haus aus ein Waldvolk, und immer noch spiegelt sich diese Herkunft im Grundzug seines Wesens ab. Die Baumverehrung der alten Germanen, der Waldglaube, der an die Jahreszeiten und ihren Wechsel gebunden war, der Hang zum Träumen, die Neigung zum Grübeln, mit einem Worte die Seelenverfassung, die die Umgebung, die Waldmasse prägte, sie lebt im vererbten Blute fort.
Wir pflegen den Laubwald, den Buchenhochwald, wenn er im zarten Maiengrün dasteht und sein von silbergrauen Säulen getragenes luftiges Blätterdach dem Himmelsblau noch den Durchblick freiläßt, gelegentlich einem Dom zu vergleichen. Wer aber hat beim stummen Anblick der feierlichen grünen Hallen je den Gedanken in sich erwogen, ob sie nicht einmal das lebende Vorbild wirklicher Dome gewesen sein könnten?
Kein Kunstgeschichtsschreiber, ein Botaniker hat ihn zum erstenmal ausgesprochen, R.H. Francé, der sein Wissenschaftsfeld durch Weitblick und Ideenreichtum so vielfältig schon bereichert hat und oft genug auch jenseits der Grenzen seines engeren Arbeitsgebietes fruchtbare neue Gedankensaat auswarf. Der gotische oder »altdeutsche« Baustil, wie man ihn ehemals zutreffend nannte, hat nach Francé seinen Ursprung im Wald. Der hochgewölbte Buchenwald mit seinen imposanten, oft bis zu zwanzig Meter Höhe vollkommen astreinen Säulenstämmen, dem leichten Netzwerk seiner Decke und seinen durch die steilen Äste und deren leicht geneigte Zweige von selbst gegebenen Spitzbogenbildungen war den Schöpfern der Gotik das Vorbild. Sie suchten nach einem Ausdruck für das, was sie tiefinnerlich erfüllte. Ihre Seele war voll von Erinnerungen an die geweihten Andachtsstätten, auf denen die Vorfahren Sonnenfeste, Ostara-, Mittsommer-, Erntefeste jahrhundertelang begangen hatten, bevor sich dem alten Väterglauben der neue des Christentums zugesellte. So bauten sie weiter »heilige Haine« in ihren Domen und Kathedralen,
steingewordene Andachtshallen mit mächtigen schlanken Strebepfeilern, die hoch im Raume sich spitzbogenförmig zum Rippengewölbe zusammenfügten. Und daß ihr Vorbild, der Waldesdom, recht deutlich zur Erscheinung komme, ließen sie ihn durch die Ornamentik der Kapitelle, Konsolen, Gesimse in seiner eigenen Sprache reden, indem sie in mannigfaltigem Wechsel das Blatt des Eichbaums, des Efeus, der Rebe, der Rose, der Stechpalme und so weiter naturgetreu oder stilisiert zu anmutiger Verwendung brachten. Sogar den wechselnden Farbenzauber des Laubwaldes wußten sie einzufangen, indem sie die ganze Skala der Töne vom strahlenden Gelb über Grün und Blau bis zum flammenden Rot in gewollter Buntheit über die Spitzbogenfenster ergossen und den gefälligen Sonnenstrahlen zum stimmungvermittelnden Spiel überließen. Mag sein, daß die Kunsthistoriker dem Deutungsversuch eines Außenseiters ihre Zustimmung vorenthalten, die stillen Verehrer und Kenner des Waldes wissen ihm freudigen Dank dafür.
Der Wald ist indessen mehr als ein Dom, mehr als ein Wecker und Befreier vom Alltag verschütteter seelischer Kraft. Sein lenzliches Blühen, Singen und Klingen, sein leises Weben in Sommertagen, sein buntes, jubelndes Herbstfarbenfest und seine verzauberte Winterschönheit empfindet jeder naturfrohe Mensch, auch wenn er den Sinn dieses Wechsels nicht kennt.
Daß aber und warum am Walde als einer auf Gleichgewicht eingestellten, unendlich verschlungenen Lebensgemeinschaft die Zukunft unserer Heimat hängt und damit die Zukunft des deutschen Volkes, davon gibt sich unter den Tausenden, die in der Waldluft Erquickung suchen, kaum einer ernsthaft Rechenschaft. Die Spaziergänger hören die Axtschläge dröhnen und wissen, die Holzhauer sind am Werk. Sie sehen zu Dutzenden lange Baumstämme auf dem Waldboden hingestreckt, vielleicht auch geschnittenes Klobenholz, nach Raummetern sorgfältig aufgeschichtet, und wissen, der Förster will Holzauktion halten. Wie vielen von ihnen steht klar vor Augen, was unser deutscher Waldbesitz von 12,6 Millionen Hektar für die Volkswirtschaft zu bedeuten hat? Der Forstwissenschaftler Hausrath belehrt uns, daß vor dem Weltkriege (seitdem fehlen verläßliche statistische Zahlen) ständig 200000 Leute in deutschen Wäldern beschäftigt waren und fünfmal so viele wenigstens teilweise ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in den Waldungen fanden. Hinzu kamen weiterhin alle jene, die mittelbar vom Walde lebten (nach der Statistik eine Million), die also bei der Holzbearbeitung für den Handel ihr Brot verdienten oder Waren und wenn er auf Nadelhölzer beschränkt ist, beherbergt er neben Fichten und Kiefern, Lärchen und Tannen wohl auch noch Eiben, aus deren Holz die alten Germanen sich ihre Waffe, den Bogen, schufen. Dieselben Sträucher, dieselben Kräuter, dieselben Blumen wie Anno einst. Erloschen ist glücklicherweise keines von den Gewächsen der Urväterzeit.
So haben wir uns damit abgefunden, daß Deutschland bis auf wenige Schlupfwinkel keinen echten Naturwald mehr hat, und Forste für Wälder zu nehmen gelernt. Wir brauchen etwas für Geist und Gemüt, das gleichzeitig Sinnbild für Deutsch und Heimat und Ausdruck für Unvergängliches ist. Etwas, das im ewigen Gleichklang, unabhängig vom Wandel der Zeiten, durch die Flucht der Jahrhunderte geht und damit Natursinn und Heimatgefühl in uns und den Nachkommen wach erhält. Das deutsche Volk ist von Haus aus ein Waldvolk, und immer noch spiegelt sich diese Herkunft im Grundzug seines Wesens ab. Die Baumverehrung der alten Germanen, der Waldglaube, der an die Jahreszeiten und ihren Wechsel gebunden war, der Hang zum Träumen, die Neigung zum Grübeln, mit einem Worte die Seelenverfassung, die die Umgebung, die Waldmasse prägte, sie lebt im vererbten Blute fort.
Wir pflegen den Laubwald, den Buchenhochwald, wenn er im zarten Maiengrün dasteht und sein von silbergrauen Säulen getragenes luftiges Blätterdach dem Himmelsblau noch den Durchblick freiläßt, gelegentlich einem Dom zu vergleichen. Wer aber hat beim stummen Anblick der feierlichen grünen Hallen je den Gedanken in sich erwogen, ob sie nicht einmal das lebende Vorbild wirklicher Dome gewesen sein könnten? Kein Kunstgeschichtsschreiber, ein Botaniker hat ihn zum erstenmal ausgesprochen, R.H. Francé, der sein Wissenschaftsfeld durch Weitblick und Ideenreichtum so vielfältig schon bereichert hat und oft genug auch jenseits der Grenzen seines engeren Arbeitsgebietes fruchtbare neue Gedankensaat auswarf. Der gotische oder »altdeutsche« Baustil, wie man ihn ehemals zutreffend nannte, hat nach Francé seinen Ursprung im Wald. Der hochgewölbte Buchenwald mit seinen imposanten, oft bis zu zwanzig Meter Höhe vollkommen astreinen Säulenstämmen, dem leichten Netzwerk seiner Decke und seinen durch die steilen Äste und deren leicht geneigte Zweige von selbst gegebenen Spitzbogenbildungen war den Schöpfern der Gotik das Vorbild. Sie suchten nach einem Ausdruck für das, was sie tiefinnerlich erfüllte. Ihre Seele war voll von Erinnerungen an die geweihten Andachtsstätten, auf denen die Vorfahren Sonnenfeste, Ostara-, Mittsommer-, Erntefeste jahrhundertelang begangen hatten, bevor sich dem alten Väterglauben der neue des Christentums zugesellte. So bauten sie weiter »heilige Haine« in ihren Domen und Kathedralen, steingewordene Andachtshallen mit mächtigen schlanken Strebepfeilern, die hoch im Raume sich spitzbogenförmig zum Rippengewölbe zusammenfügten. Und daß ihr Vorbild, der Waldesdom, recht deutlich zur Erscheinung komme, ließen sie ihn durch die Ornamentik der Kapitelle, Konsolen, Gesimse in seiner eigenen Sprache reden, indem sie in mannigfaltigem Wechsel das Blatt des Eichbaums, des Efeus, der Rebe, der Rose, der Stechpalme und so weiter naturgetreu oder stilisiert zu anmutiger Verwendung brachten. Sogar den wechselnden Farbenzauber des Laubwaldes wußten sie einzufangen, indem sie die ganze Skala der Töne vom strahlenden Gelb über Grün und Blau bis zum flammenden Rot in gewollter Buntheit über die Spitzbogenfenster ergossen und den gefälligen Sonnenstrahlen zum stimmungvermittelnden Spiel überließen. Mag sein, daß die Kunsthistoriker dem Deutungsversuch eines Außenseiters ihre Zustimmung vorenthalten, die stillen Verehrer und Kenner des Waldes wissen ihm freudigen Dank dafür.
Der Wald ist indessen mehr als ein Dom, mehr als ein Wecker und Befreier vom Alltag verschütteter seelischer Kraft. Sein lenzliches Blühen, Singen und Klingen, sein leises Weben in Sommertagen, sein buntes, jubelndes Herbstfarbenfest und seine verzauberte Winterschönheit empfindet jeder naturfrohe Mensch, auch wenn er den Sinn dieses Wechsels nicht kennt. Daß aber und warum am Walde als einer auf Gleichgewicht eingestellten, unendlich verschlungenen Lebensgemeinschaft die Zukunft unserer Heimat hängt und damit die Zukunft des deutschen Volkes, davon gibt sich unter den Tausenden, die in der Waldluft Erquickung suchen, kaum einer ernsthaft Rechenschaft. Die Spaziergänger hören die Axtschläge dröhnen und wissen, die Holzhauer sind am Werk. Sie sehen zu Dutzenden lange Baumstämme auf dem Waldboden hingestreckt, vielleicht auch geschnittenes Klobenholz, nach Raummetern sorgfältig aufgeschichtet, und wissen, der Förster will Holzauktion halten. Wie vielen von ihnen steht klar vor Augen, was unser deutscher Waldbesitz von 12,6 Millionen Hektar für die Volkswirtschaft zu bedeuten hat?
Der Forstwissenschaftler Hausrath belehrt uns, daß vor dem Weltkriege (seitdem fehlen verläßliche statistische Zahlen) ständig 200000 Leute in deutschen Wäldern beschäftigt waren und fünfmal so viele wenigstens teilweise ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in den Waldungen fanden. Hinzu kamen weiterhin alle jene, die mittelbar vom Walde lebten (nach der Statistik eine Million), die also bei der Holzbearbeitung für den Handel ihr Brot verdienten oder Waren oder verwüsten ließ, muß immer noch tief in den Staatssäckel greifen, um wenigstens einigermaßen die Schäden durch Aufforstung wieder wettzumachen. Und ebenso büßen die Franzosen noch heute den schmachvollen Frevel ab, den unbeschwerte Spekulanten während der Großen Revolution an ihrem Vaterlande verübten, indem sie dreieinhalb Millionen Hektar Waldungen fällen ließen. Wo immer im Bergland oder am Meere ein grüner Schutzwall umgelegt wurde, hat die Natur solchen Eingriff gerächt. Im Gebirge trocknet der Boden aus, wenn ihn die Axt seines Waldkleids beraubt. Unfähig, wie früher im Schutz der Bäume Schmelzwasserfluten und Regengüsse in seinen moosigen Grund zu saugen und wenigstens so lange festzuhalten, daß sie nicht jählings talabwärts stürzen, weicht der Boden in völliger Ohnmacht dem wütenden Ansturm der Wasserkraft, die ihn gemeinsam mit festen Stoffen, mit Gesteinsblöcken jeder Größe, als »Mur« mit in den Abgrund reißt. Wo solche gewaltigen Schutt- und Schlammassen donnernd an Berghängen abwärtsrasen, nehmen sie jedes Hindernis mit, zerstören Gebäude und fruchtbare Gärten, verwüsten nicht selten weite Täler und bringen die darin wohnenden Menschen erbarmungslos an den Bettelstab. Harmlos hüpfende Wässerlein, die im gehüteten Gebirgswald den
Wanderer durch ihr Gemurmel erheitern, können zu reißenden Wildbächen werden, wenn Eigennutz sich am Bergwald vergreift.
An Meeresküsten sind es die Dünen, die durch den Wald gebunden werden, bloßgelegt aber langsam und stetig in breiter Front landeinwärts wandern und fruchtbares Land unter Flugsand begraben. Ein Beispiel dafür ist die Frische Nehrung zwischen den Städten Danzig und Pillau, die unter Friedrich Wilhelm I. ihre Waldbedeckung verlor. Die Abholzung half zwar die Kassen füllen, wandelte aber weite Landstrecken in eine trostlose Sandwüste um. Unermeßlich ist der Segen, den Wälder über ein Land verbreiten, wenn sie als Segnung empfunden werden. Als Segnung in voller Wortbedeutung. Nicht nur im volkswirtschaftlichen Sinne als Erzeuger des Holzbedarfs und vieler gewerblicher Notwendigkeiten, als Schutzwall gegen Naturkatastrophen und Erhalter der Volksgesundheit, sondern auch im ethischen Sinne als Quellgrund starken Heimatglaubens und enger Naturverbundenheit.
Wir sind durch die Mechanisierung des Lebens infolge der übersteigerten Technik schon allzu sehr der Natur entfremdet, besonders wenn uns ein widriges Schicksal ins Großstadtgetriebe verschlagen hat. Die Maschinen, durch Menschengeist geschaffen, sind drauf und dran, ihren Herrn und Meister unter ihre Gewalt zu zwingen, ihn zu verdrängen, zu ersetzen und ihm die Mitgift seiner Altvordern, das vererbte Jägerblut, nach Vampirart aus den Adern zu saugen. Schon gibt es unzählige Großstadtkinder, die über Flugzeuge, Automobile und andere technische Alltagswunder sachkundiger als Erwachsene reden, doch nie einen Wald betreten haben, geschweige seine Wunder erlebt. Das muß nicht sein und das darf nicht sein.
Streicht alles fürs künftige Leben Tote schonungslos aus den Unterrichtsplänen. Führt die Jugend wieder und wieder unter das gotische Laubdach der Wälder und lehrt sie die Heimat in ihnen sehen! Erzählt ihr, was seit Armins Tagen der Wald dem germanischen Volke war, wie er die Willensfestigkeit, die Sinnes-, Geistes-, Gemütsart prägte, wie Fest und Brauch, wie Lied und Glaube im Walde ihre Wurzeln hatten und wie das alles heute noch zutiefst im deutschen Blute lebt und sich in den Werken der Kunst und Dichtung, in unseren Sagen und Märchen spiegelt. Erlahmt nicht, bis in jedem Jungen ein Heimatpfleger erzogen ist, der einmal um jeden Baum im Walde, den frevelnde Hände verderben wollen, mit Begeisterung kämpfen wird. »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein«, schrieb einer der besten Heimatkenner, F.W. Riehl, vor achtzig Jahren unter dem Eindruck der Waldverwüstung
im »tollen Jahre« 1848. »Auch wenn wir keines Holzes bedürfen, brauchen wir dennoch unseren Wald. Brauchen wir das dürre Holz nicht mehr, um unsern äußeren Menschen zu wärmen, dann wird dem Geschlecht das grüne, in Saft und Trieb stehende zur Erwärmung des inwendigen Menschen um so nötiger sein. Wie die See das Küstenvolk in seiner rohen Ursprünglichkeit frisch erhält, so bewirkt das gleiche der Wald bei den Binnenvölkern. Weil Deutschland so viel Binnenland hat, darum braucht es um so viel mehr Wald als England. Rottet den Wald aus, ebnet die Berge und sperrt die See ab, wenn ihr die Gesellschaft im gleichgeschliffenen Allerweltsmaß der Geistesbildung erhalten wollt! ... Ein Volk muß absterben, wenn es nicht mehr zurückgreifen kann zu den Hintersassen in den Wäldern, um sich bei ihnen neue Kraft des natürlichen Volkstums zu holen. Eine Nation ohne beträchtlichen Waldbesitz ist gleichzuachten einer Nation ohne gehörige Meeresküsten. Wir müssen den Wald erhalten, nicht damit uns der Ofen im Winter nicht kalt werde, sondern auch, damit die Pulse des Volkslebens warm und fröhlich weiterschlagen, damit Deutschland deutsch bleibe!«