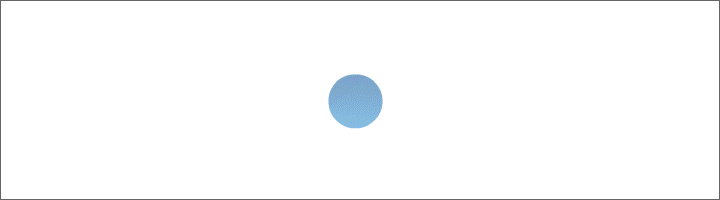Berufe im Wandel der Zeit
In Ehrbarkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit
So werden noch heute die Innungsversammlungen eröffnet, dabei wird mit dem Holzhammer laut auf die Innungslade geschlagen.
Das Tischlerhandwerk historisch betrachtet
Schreiner oder Tischler?
Regionale Verteilung der Bezeichnung Schreiner - Tischler
Quelle: DTV-Atlas Namenkunde
Mit dem Aufkommen einer anspruchsvollen städtischen Wohnkultur seit dem zwölften Jahrhundert bildete sich die Möbelherstellung, die ursprünglich zu den Aufgaben der Zimmerleute zählte, als eigener Handwerkzweig heraus.
Die Bezeichnung für diesen Handwerkszweig wurde aus den wichtigen Möbelstücken abgeleitet.
Von der römischen "cista" - Truhe, Schrank - entlehnten die Germanen das Wort Kiste, welches die älteste Herstellerbezeichnung lieferte, den Kistler im Süden, den Kistenmacher im Norden.
Seit dem späten Mittelalter aber veränderte der Begriff Kiste seine Bedeutung in Richtung immer unedlerer Behälter aus Holz. Daher setzten sich andere Bezeichnung für den Möbelhersteller durch, so das Kistler etwa seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr gebräuchlich ist.
Aus Lateinisch "scrinium" - runde Kapsel – wurde schon früh Schrein als Bezeichnung für ein kostbares kirchliches Gefäß entlehnt.
Im Mittelhochdeutschen bezeichnete es dann auch Möbel, Kommoden oder Truhen.
Für ihre Hersteller lässt sich im oberdeutschen seit dem 13. Jahrhundert die Bezeichnung Schreiner im rheinischen Schreinemarker nachweisen.
Aus lateinisch "discus" – Schüssel – ist bei den Germanen für kleine, auf einem Gestell angebrachte Holzplatten mit einer Vertiefung als Eßschüssel das Wort Tisch entstanden.
Das daraus abgeleitetes Tischer für den Möbelhersteller ist Ende bis 14 Jahrhundert zuerst in Breslau belegt, der Begriff Tischler in Wien Mitte des 15. Jahrhunderts.
Heute gelten in der Standardsprache Tischler und Schreiner nebeneinander. In den Dialekten ist das eine im Osten, das andere im Westen üblich.
Je nach Region des deutschen Sprachgebietes hat dieses Handwerk einen anderen Namen. Nach dem Wortatlas der deutschen Umgangssprachen ist die regionale Verteilung wie folgt:
- in Nord-, West- und Ostdeutschland, Österreich und Südtirol sagt man Tischler.
- vereinzelt im Ruhrgebiet, in Hessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und Bayern, sowie in der Deutschschweiz und Westösterreich (insbesondere Vorarlberg) sagt man Schreiner.

Konkretisierung des Berufes in Mitteleuropa
- Mit dem Ende des Weströmischen Reichs und dem aufdämmern des Mittelalters wurden die bisher eher gelegentlich und freiwillig geleisteten Handwerksdienste von der Obrigkeit geregelt.
- Nun wurde jedem Mann sein Dienst im Gemeinwesen vom Machthaber zugewiesen. Die früher freiwillig ausgeübte Tätigkeit wurde zur Pflicht gemacht.
- Aus dem gelegentlichen Handwerksdienst wurde ein Amt, das die Söhne des Trägers nach dessen Tode übernehmen mussten und in das sie gleichsam hineingeboren wurden.
- Das älteste Dokument einer solchen hofrechtlichen Aufteilung der handwerklichen Tätigkeit ist das sogenannte »Capitulare de Billis«, ein Gesetz, das Kaiser Karl der Große für die Verwaltung der Königlichen Grundherrschaften erlassen hat (um ca. 800).
- Das Gesetz zählt die verschiedenen Gewerbe auf, die durch berufsmäßig geübte Handwerker besetzt sein sollen.
- Folgenden Gebiete gehörten dazu: Bewaffnung, Jagd, Fischerei, Nahrung, Kleidung, Schmuck, Hausbau, darunter Schreiner, Drechsler und Zimmerleute.
- Die Holzarbeiter, die noch allein den hölzernen Hausbau auszuführen hatten, unterstanden dem Marschall, der in Gemeinschaft mit dem Kämmerer, dem Truchsetz und dem Schenken die Hofverwaltung bildete.
– der Steinbau wurde erst im 14. Jahrhundert allgemeiner und war noch fast ganz unbekannt –
- Die Vererbung der Ämter hatte, da mancher Handwerker mehrere Söhne als Amtsbrüder heranziehen konnte, ein allmähliches Wachsen des Berufsstandes zur Folge und machte die Anstellung neuer Handwerker von außen überflüssig.
- War ein handwerklicher Berufsstand zahlreich genug geworden, so wurde ihm ein besonderer Vorsteher (Magister) übergeordnet, der der Träger ihrer eigenen Gerichtsbarkeit wurde, während die Handwerkerschaft den Träger der gewerblichen Selbstverwaltung darstellte.
Zunftwesen
- Die Anfänge sind im Hochmittelalter zu finden, als zahlreiche neue Städte gegründet wurden (Stadtgründungsphase) und die Handwerkszweige in den Städten sich stark spezialisierten.
- Aus dem Zimmermannsberuf entwickelte sich der Beruf des Tischlers,
- um 1308 taucht erstmalig die Bezeichnung Tischler auf. In der Folge blieben dem Zimmermann die rohen, genagelten, derberen Arbeiten, die feinere und die geleimte Arbeit war Sache des Schreiners.
Goldene Zeit des Handwerks
- Durch den Einfluss von Renaissance und Humanismus änderte sich das Weltverständnis. Es erwuchs eine bejahende Lebensauffassung und Kultur.
- Zunehmender Wohlstand in den. Städten führte zu gesteigerten Bedürfnissen nach geistigen und kulturellen Werten und der Nachfrage nach einer Vielfalt von hochentwickelten hand- und kunsthandwerklichen Erzeugnissen.
- Letztlich führte es auch zu einer Blütezeit des deutschen Kunstgewerbes, das in der innigen Verbindung von Kunst und Handwerk seine Stärke hatte.
- Auch das städtische Schreinerhandwerk brachte in dieser Phase herausragende Leistungen in der Formgebung und Ausführung von gediegenen Möbeln hervor.
- Man nahm aus Italien Gestaltungsprinzipien für die Flächengliederung und neue Techniken wie z.B. die Intarsia auf und setzte sie in eigenständigen Entwürfen um.
- Einige Schreinereien entwickelten sich zu Kunstschreinereien, und so wurde der Schreiner zum Ebenisten. Die Kunstschreiner jener Zeit waren gerühmt und gesucht. Fürsten hielten sich eigene Hofebenisten.
- Die Handwerkerzünfte verstanden sich als kirchliche Bruderschaften, sie errichteten Mess-Stiftungen und wirkten kirchlich-karitativ für ihre Mitglieder, wenn diese in Not geraten waren.
- Große Bedeutung hatten die Zünfte im gesellschaftlichen Leben der handwerklichen Bürgerschicht.
- Die Zunfthäuser mit den Zunftladen waren der Mittelpunkt für die Versammlungen der Zunftmeister.
- In den Zunftstatuten war das wirtschaftliche Leben geregelt.
- Die Arbeitszeit,
- der Zugang zum Handwerk,
- die Zulassung zur Meisterprüfung,
- das Verhältnis der Meister, Gesellen und Lehrlinge untereinander,
- die Rechte und Pflichten der Zunftangehörigen,
- schließlich die Sorge für einwandfreie Rohstoffe und für die Qualität der Verarbeitung,
- die Preisgestaltung und die Regelung des Wettbewerbes wurden in den Statuten genossenschaftlich festgelegt.
- Bald spielte auch die hoheitliche Bestätigung der Zunftsatzungen eine bedeutende Rolle.
- Mit dem im Spätmittelalter wachsenden Wettbewerb verschärften die Zünfte die Bestimmungen über die Zulassung zur Ausbildung.
- Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden die Zunftbestimmungen immer kleinlicher und engherziger, die Vergehen gegen diese Bestimmungen zunehmend strenger geahndet.
- Die einschneidenden Produktions- und Verkaufsbestimmungen sollten zwar dem Handwerker helfen, in Wirklichkeit erwiesen sie sich jedoch in der Folge als Hemmschuh. Sie erwuchsen letztlich aus der Konkurrenzangst der eingesessenen Meister.
- Um den enger werdenden Lebensraum in den Städten für die bereits Selbständigen abzusichern, versperrte man vielfach den Gesellen zunehmend den Aufstieg in die Selbständigkeit dadurch, dass die Zugangsvoraussetzungen zur Zunft höher gesetzt wurden.
- In zeitlicher Hinsicht durch Forderungen an eine längere Dauer der Ausbildungs- und Gesellenzeit sowie der Wanderschaft,
- in finanzieller Hinsicht durch unangemessen hohe Forderungen an Aufnahmegebühren und oft zudem durch den verbürgten Nachweis der Verfügung über beträchtliches eigenes Vermögen.
- Vom ausgehenden 16. bis zum beginnenden 17. Jahrhundert wurden die Zunftschranken immer starrer, es entstanden sog. „geschlossene Zünfte“. Das bedeutete, dass eine Höchstzahl an Meistern pro Zunft festgesetzt wurde.
- Der Erwerb der Meisterschaft wurde damit erschwert und fremden, zugewanderten Gesellen oft unmöglich gemacht.
- Gleichzeitig schwächte sich das soziale Pflichtbewusstsein ab, und die Zünfte erstarrten in Formalismus, Geldstrafensystemen und anderen regulierenden Maßnahmen.
- Diese Entwicklung brachte das Handwerk und die Zünfte in Misskredit.
Folgen des Zunftzwangs
- Die Schweiz proklamierte am 19.10.1798 die Gewerbefreiheit und hob den Zunftzwang auf.
- In Preußen wurde 1810 die Gewerbefreiheit eingeführt.
- In 1859 erließ Franz Josef I. in Österreich eine Gewerbeordnung, die, wohl unter dem Druck der Industrialisierung, auf dem Grundsatz der Gewerbefreiheit stand.
- am 21. Juni 1869 wurde die Gewerbefreiheit per Reichsgesetz auf das ganze Land ausgeweitet